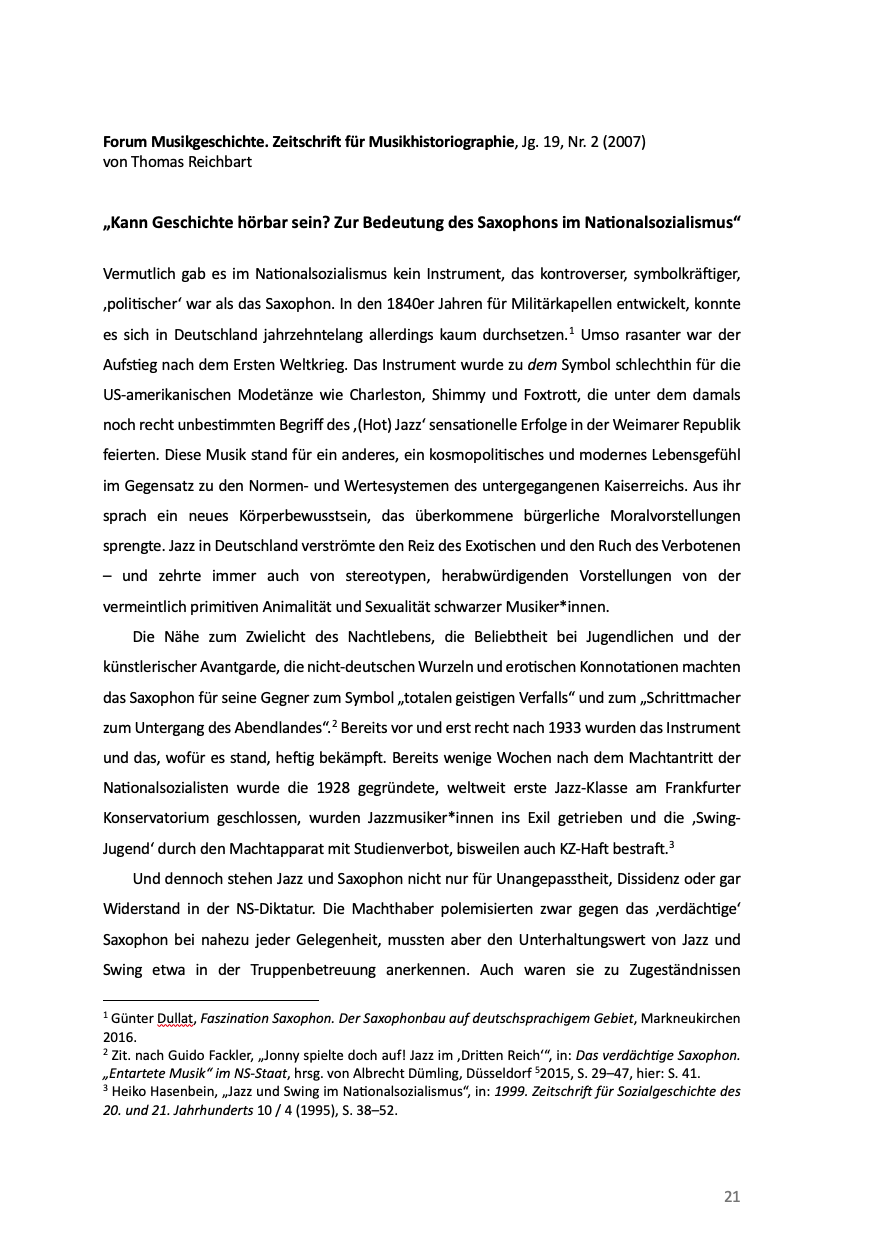Inhalt
Die Musikwissenschaft als universitäre Disziplin entstand im deutschsprachigen Raum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seither hat sich das Fach stark weiterentwickelt und ausdifferenziert. Deshalb sollte weniger von der Musikwissenschaft, sondern eher von den Musikwissenschaften gesprochen werden. Womit sich Musikwissenschaftler_innen beschäftigen und auf welche Weise sie das tun, ist daher sehr unterschiedlich, vom jeweiligen Erkenntnisinteresse abhängig und stets dem historischen Wandel unterworfen.
Drei (mögliche) Definitionen für Musikwissenschaft:
Musikwissenschaft ist die Wissenschaft von der Musik.
(Michele Calella, "Orientierung am Studienbeginn", in: Musikwissenschaft studieren. Arbeitstechnische und methodische Grundlagen, hg. von Kordula Knaus, Andrea Zedler, 2., aktual. Auflage, München 2019, S. 15–25, hier: S. 15)
[Die Musikwissenschaft hat] das Ziel, musikalische Erscheinungsformen sowie die Zusammenhänge, in denen sie stehen, zu erkennen und den gegenüber bereits bestehender Erkenntnis gewonnenen Erkenntnisfortschritt in sprachlicher Form zu äußern.
(Nicole Schwindt-Gross, Musikwissenschaftliches Arbeiten. Hilfsmittel – Techniken – Aufgaben, 5. Aufl., Kassel 2003, S. 12)
Die Musikwissenschaft [...] ist eine akademische Disziplin, die der Erforschung musikalischer Repertoires und darauf bezogener Praktiken und Diskurse sowie der Reflexion über Musik in der Vielfalt ihrer historischen, kulturellen und sozialen Erscheinungsformen gewidmet ist, aber auch die akustischen, biologischen und psychologischen Grundlagen der Musikproduktion und -rezeption berücksichtigt.
(Melanie Wald-Fuhrmann, Art. "Musikwissenschaft", in: MGG Online, hg. von Laurenz Lütteken, New York, Kassel, Stuttgart 2016ff., veröffentlicht Juni 2022, https://www-1mgg-2online-1com-16dgawa8h3dc7.emedia1.bsb-muenchen.de/mgg/stable/406845)
Worin gleichen und worin unterscheiden sie sich?
Obwohl es sehr unterschiedliche Auffassungen über Gegenstand und Methoden der Musikwissenschaften gibt, lässt sich für sie – wie auch für jede andere Wissenschaft – ein gemeinsames Ziel formulieren: wahre Aussagen über einen bestimmten Gegenstand zu treffen sowie vollständig zu dokumentieren und schlüssig zu begründen, wie diese Aussagen zustandegekommen sind.
Erkenntnisse, die mithilfe wissenschaftlicher Arbeitstechniken gewonnen werden und einen Wahrheitsanspruch erheben ("wissenschaftliches Wissen"), unterliegen daher besonders hohen Qualitätsanforderungen. Diese Anforderungen lassen sich durch vier Kriterien beschreiben (nach Rösing/Petersen 2000, S. 26–37):
- Objektivität/Intersubjektivität: Wissenschaftliches Wissen soll möglichst frei von subjektiven Ansichten, Werturteilen und Überzeugungen (Meinungen) sein. Allerdings ist völlige Objektivität nie zu erreichen, da wissenschaftliche Texte immer von Einzelpersonen (Erkenntnissubjekten) mit individuellen Geschmacksvorstellungen und Vorlieben verfasst werden. Die eigenen Vorannahmen sind deshalb stets kritisch zu hinterfragen und eigene Überlegungen deutlich als solche kenntlich zu machen, damit sie von anderen Erkenntnissubjekten als solche erkannt werden können (Intersubjektivität).
- Überprüfbarkeit: Die einzelnen Schritte des Erkenntnisprozesses (Methoden, Quellen, Gedankengänge) müssen offengelegt werden und für jeden nachvollziehbar sein (z.B. im Wissenschaftlichen Apparat). Alle, die dieselbe Fragestellung verfolgen, dieselben Quellen verwenden und dieselben Methoden anwenden, sollten zu demselben Ergebnis gelangen. Auch müssen die Erkenntnisse dauerhaft gesichert werden (in der Regel durch einen Text), damit sie auch noch in Zukunft überprüfbar bleiben.
- Widerspruchsfreiheit: Aus dem Wahrheitsanspruch von wissenschaftlichem Wissen folgt, dass zwei widersprüchliche Aussagen nicht gleichzeitig wahr sein können (Konsistenz). Gibt es zwei sich widersprechende Ansichten zu einem Thema (etwa bei der Formanalyse eines Werks), so muss begründet werden, warum die eine Ansicht der anderen vorzuziehen ist oder möglicherweise beide Ansichten korrigiert werden müssen.
- Diskursivität: Der wissenschaftliche Erkenntnisprozess verläuft nicht nur in Auseinandersetzung mit Primärquellen, sondern auch in der Beschäftigung mit dem, was andere Wissenschaftler_innen bereits zum Gegenstand geschrieben haben (s. Sekundärliteratur). Dieser Forschungsdiskurs ist stets einzubeziehen und zu diskutieren. Damit soll sichergestellt werden, dass Forschungsarbeit nicht unnötig doppelt gemacht wird, sondern zu neuen Erkenntnissen führt.
Sämtliche Arbeitstechniken, die in diesem Handbuch erläutert werden, dienen dem Ziel, die Kriterien von Wissenschaftlichkeit zu erfüllen.
Identifiziere in dem folgenden – fiktiven – Text mögliche Kennzeichen für Wissenschaftlichkeit (das Kriterium der Widerspruchsfreiheit muss hier nicht geprüft werden)!
Handelt es sich jeweils um wissenschaftliche Literatur? Warum (nicht)?

Svenja Wieser, Thomas Schulz, "Münchner Komponist zwischen den Welten", in: BR-Klassik, 5.7.2022, https://www.br-klassik.de/aktuell/paul-ben-haim-komponist-jubilaeum-geburtstag-125-jahre-100.html (letzter Zugriff: 22.11.2023)
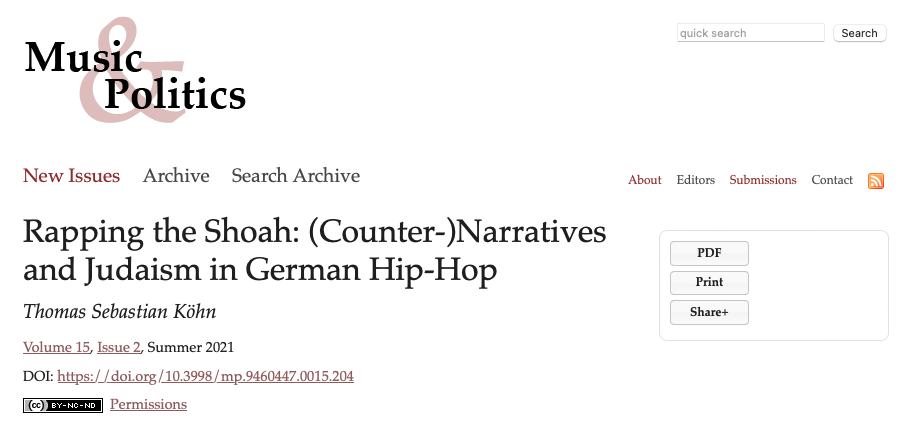
Thomas Sebastian Köhn, "Rapping the Shoah: (Counter-)Narratives and Judaism in German Hip-Hop", in: Music & Politics 15, Nr. 2 (Sommer 2021), https://doi.org/10.3998/mp.9460447.0015.204 (letzter Zugriff: 22.11.2023)
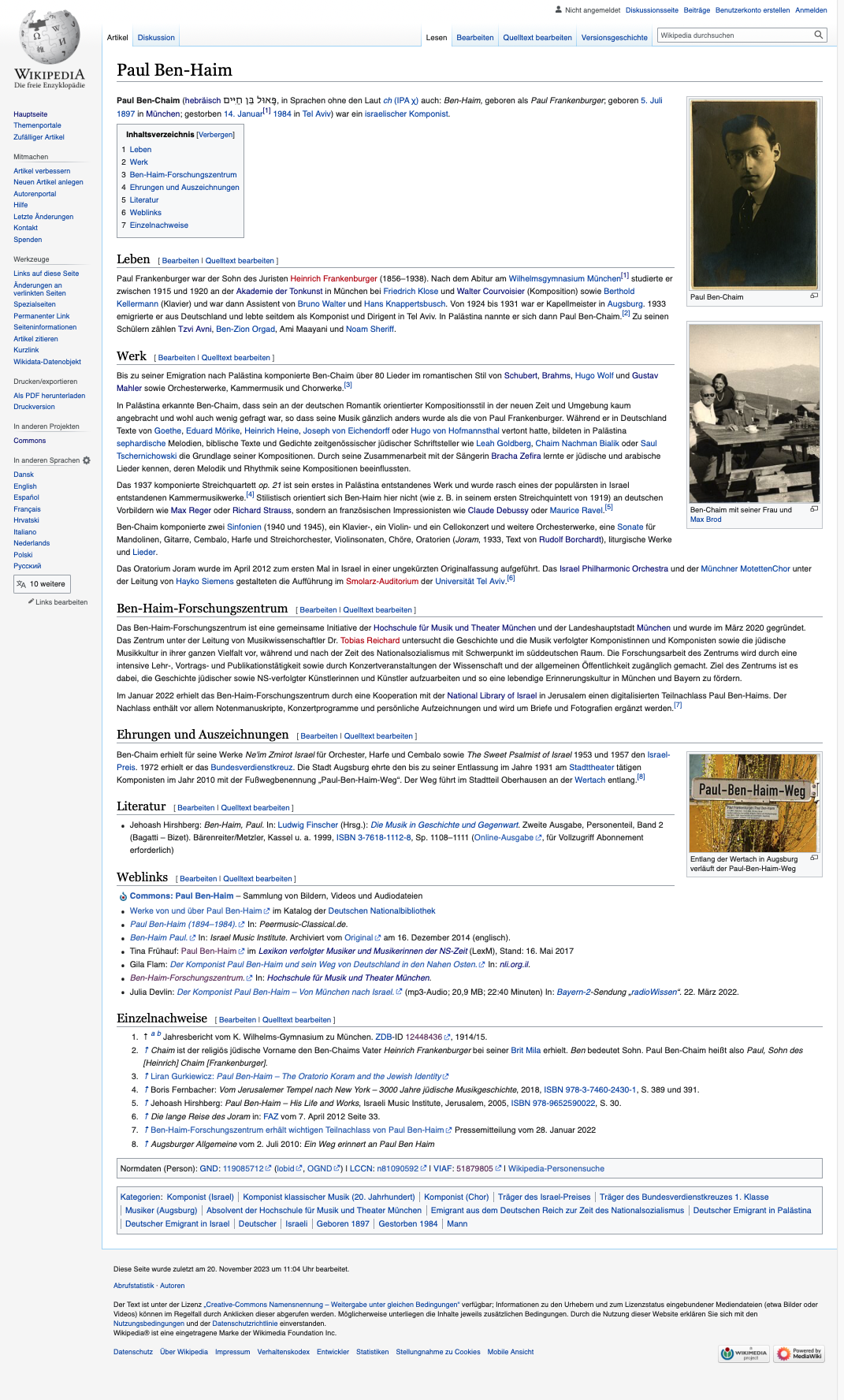
Quelle: Wikipedia
Musikwissenschaftliche Einführungen:
- Matthew Gardner, Sara Springfeld, Musikwissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung, 2. Auflage, Kassel u.a. 2018.
- Kordula Knaus, Andrea Zedler (Hg.), Musikwissenschaft studieren. Arbeitstechnische und methodische Grundlagen, 2., aktualisierte Auflage, München 2019.
- Helmut Rösing, Peter Petersen, Musikwissenschaft. Was sie kann, was sie will, Reinbek bei Hamburg 2000.
- David Beard, Kenneth Gloag, Musicology: The Key Concepts, New York, NY ; Abingdon, Oxon 2016.
- Aaron Williamson, Jane Ginsborg, Rosie Perkins, George Waddell, Performing Music Research: Methods in Music Education, Psychology, and Performance Science, Oxford University Press 2021.
- J.P.E. Harper-Scott, Jim Samson (Hg.), An Introduction to Music Studies, Cambridge, UK , New York 2009.
- Tim Crawford, Lorna Gibson (Hg.), Modern Methods for Musicology: Prospects, Proposals, and Realities, Farnham, England ; Burlington, VT 2009.
- Laurie J. Sampsel, Music Research: A Handbook, New York [u.a.] 2009.
Wissenschaftliche Arbeitstechniken allgemein:
- Norbert Franck, Joachim Stary (Hg.), Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung, 17., überarbeitete Auflage, Paderborn 2013.