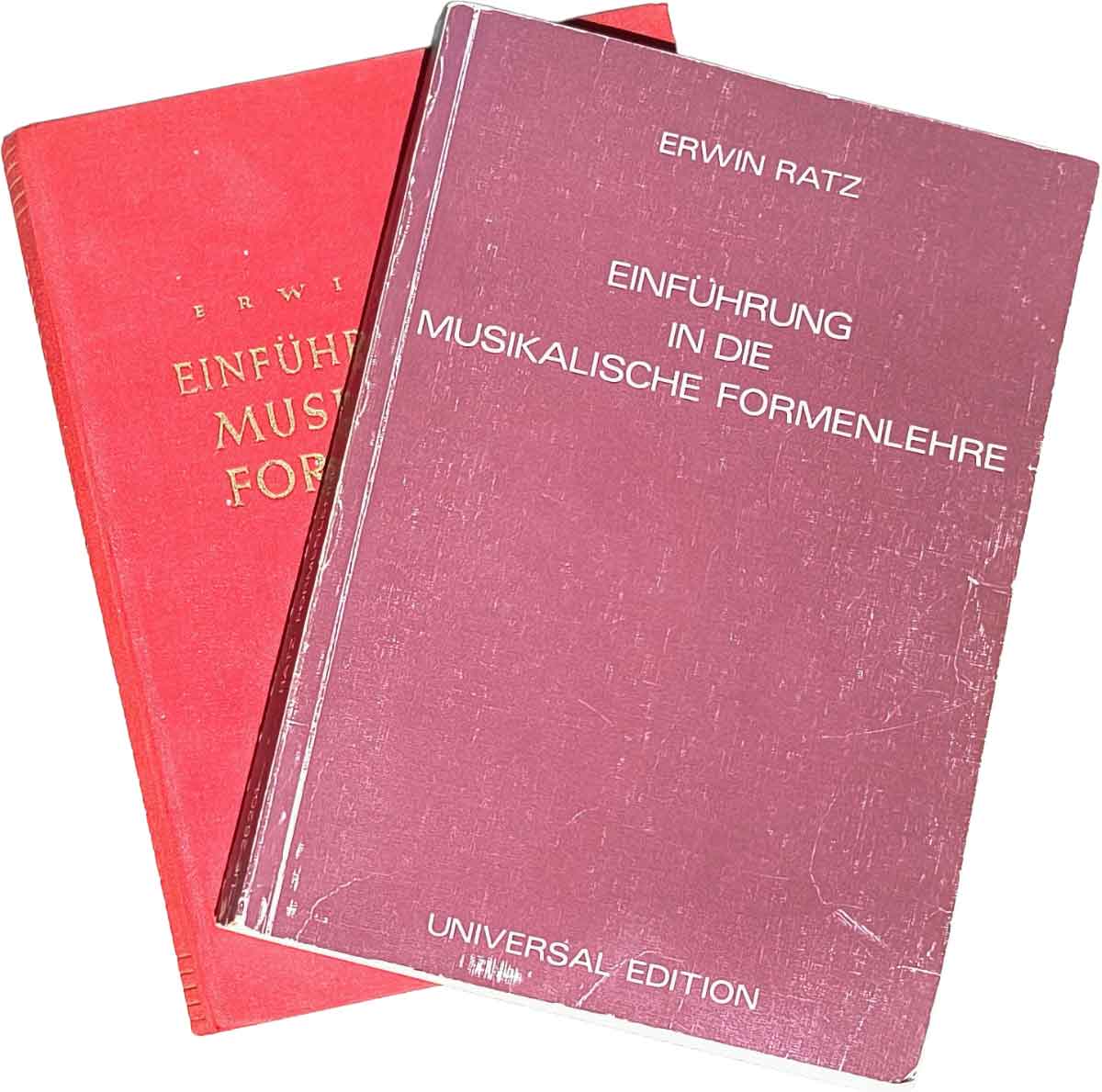
Erwin Ratz – Musikalische Formenlehre, Erstausgabe 1951 und 3. erw. Ausg. 1973. Lizenz: CC0-1.0
Die Einführung in die musikalische Formenlehre von Erwin Ratz zählt zu den einflussreichsten musiktheoretischen Schriften des 20. Jahrhunderts. Auf der Grundlage von Arnold Schönbergs Denken entwarf Ratz Modelle zur Formanalyse von Musik, die Generationen von Musikstudierenden geprägt hat. Seine Formenlehre wurde intensiv rezipiert. Insbesondere die Modelle Periode und Satz dürften heute noch vielen Studierenden vertraut sein und zur Analyse von Musik des 18. Jahrhunderts verwenden werden. Nur wenige dürften diese Modelle allerdings aus der Formenlehre von Erwin Ratz kennen (es ist ein recht umfangreiches Lehrbuch mit viel Text). Vielmehr haben seine Ideen durch einflussreiche Didaktisierungen wie z.B. der Formenlehre von Clemens Kühn oder Internetquellen großen Einfluss genommen. Auch die nordamerikanische Musiktheorie ist von Denkmodellen, die Erwin Ratz ausgearbeitet hat, stark beeinflusst worden.
In diesem Tutorial kannst du wichtige Modelle und Ideen sowie den geistesgeschichtlichen Kontext der Formmodelle von Erwin Ratz kennenlernen.
Inhalt
Themen
Periode und Satz
Die bekanntesten Modelle der Formenlehre von Erwin Ratz für idealtypisch achtaktige Einheiten dürften Periode und Satz sein. Erwin Ratz erläutert:
Die Achttaktigkeit stellt nur den häufigsten Fall dar: Selbstverständlich kommen auch alle Vielfachen vor. Ebenso kann eine sechstaktige Periode aus einem dreitaktigen Vordersatz und einem dreitaktigen Nachsatz bestehen oder ein zwölftaktiger Satz aus einem Dreitakter, seiner Wiederholung und einer sechstaktigen Entwicklung. Überdies gibt es durch Dehnungen und Verkürzungen unregelmäßige Bildungen. Der Achttakter ist nur das Paradigma, der Normalfall.
Erwin Ratz, Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien 1951, S. 22.
Anschließend werden für diese Modelle Beispiele gegeben. Ratz schreibt:
Als Beispiel für die achttaktige Periode diene der erste Teil des als dreiteiliges Lied gebautes Hauptthema aus dem Largo der Sonate Op 2 Nr. 2:
a.a.O., S.23.

Ludwig van Beethoven, Klaviersonate A-Dur Op. 2 Nr. 2 Largo appassionato T. 1–8, Lizenz: CC0-1.0
Ludwig v. Beethoven, Klaviersonate Op. 2, Nr. 2, Largo appasionato,
Klavier: Alfred Brendel, Quelle: YouTube
Als Beispiel für die achttaktigen Satz sei das Hauptthema des ersten Satzes der f-Moll-Sonate Op 2 Nr. 1 aufgeführt:
a.a.O.

Ludwig van Beethoven, Klaviersonate f-Moll Op. 2 Nr. 1 Allegro T. 1–8, Lizenz: CC0-1.0
Ludwig v. Beethoven, Klaviersonate Op. 2, Nr. 1, Allegro, Klavier: Alfred Brendel, Quelle: YouTube
Zu den Typen (Modellen) merkt er an:
In den beiden beschriebenen Typen der Periode und des Satzes handelt es sich sozusagen um eindeutig bestimmbare Grenzfälle entgegengesetzten Charakters. In der Praxis werden wir natürlich häufig auch Fällen begegnen, die nicht eindeutig dem einen oder andere Typus zuzurechnen sind. Aber erst wenn wir das Gegensätzliche im Wesen der beiden Bauarten, die jedoch das f e s t e Prinzip repräsentieren, richtig erfasst haben, können wir uns in der Buntheit der Erscheinungen zurechtfinden.
a.a.O., S. 24.
Erwin Ratz versteht Periode und Satz als Idealtypen (Modelle), die sich im Wesen unterscheiden, also eine ausgewogene Symmetrie im Gegensatz zur asymmetrische Entwicklung. Im Diagramm lassen sie sich die Modelle wie folgt veranschaulichen:
fest & locker
Prinzip des fest- und locker Gefügten
Dem Zitat oben lässt sich entnehmen, dass Erwin Ratz im Zusammenhang mit Periode und Satz von einem festen Prinzip gesprochen hat. Mit den Prinzipien einer festen und lockeren Bauweise hat Ratz ein weiteres Gedankenmodell für die musikalische Analyse bereitgestellt:
Allgemein ausgedrückt können wir zwei Gestaltungsprinzipien feststellen: fester Gefügtes (hierher rechnen wir vor allem den Hauptgedanken, bis zu einem gewissen Grade auch die Schlußsätze) und locker Gefügtes (vor allem: Seitensatz, Überleitung, Rückführung, Durchführung, aber auch schon innerhalb des Hauptgedankens – sofern er als dreiteiliges Lied gebaut ist – den zweiten Teil). Zur Erzielung des festen Zustandes dienen vor allem harmonische Mittel (das eindeutige Feststellen und Festhalten der Haupttonart mittels Kadenz), ferner bestimmte thematische, bzw. motivische Strukturen, als deren wichtigste wir für die Form des Hauptgedankens die achttaktige Periode, den achttaktigen Satz und das dreiteilige Lied (8+4+4) anzusehen haben. Die Periode (4+4) besteht aus einem Vordersatz und einem Nachsatz, wobei der Vordersatz in der Regel auf einem Halbschluß endigt, der Nachsatz so wie der Vordersatz beginnt und mit einem Ganzschluß endigt.
a.a.O. S. 22.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Ratz die fest gefügte Bauweise für folgende Formfunktionen der Sonatenhauptsatzform charakteristisch ist:
- Hauptgedanken bzw. Themen in der Bauweise
- Periode (mit regelmäßigem Aufbau von 4 + 4 Takten)
- Satz (mit regelmäßigem Aufbau von 2 + 2 + 4 Takten) oder
- Dreiteiliges Lied (ABA mit regelmäßigem Aufbau von 8 + 4 + 4 Takten)
- Schlusssätze (zu einem gewissen Grad)
Das Prinzip einer locker gefügten Bauweise sieht er dagegen als Wesen der folgenden Formfunktionen an:
- Überleitung
- Seitensatz
- modulierenden Seitensatz
- sich »grundsätzlich vom Hauptgedanken unterscheidenden Seitensatz«
- Durchführung oder B-Teil einer dreiteiligen Liedform (Mittelteile)
- von der Haupttonart zur Dominante der Zieltonart führend
- »Stehenbleiben auf der Dominante der Zieltonart« (Rückführung)
Das folgende Diagramm veranschaulicht die Formfunktionen der Sonatenhauptsatzform und deren wesenhaften Beschaffenheit (fest/locker):
Goethe, Ratz und Schenker
Verweise auf Goethes naturwissenschaftliche Schriften finden sich um 1900sehr häufig, z.B. in der Biologie von Ernst Haeckel, der Philosophie von Bruno Wille, der Poesie von Wilhelm Boelsche und der Theosophie Rudolf Steiners. Erwin Ratz hatte 1921 aus finanziellen Gründen eine Stelle als Sekretär am Bauhaus angenommen. Für ein bis zwei Jahre arbeitete er dort und eine ganze Künstlergeneration des Bauhauses und frühen Expressionismus wie zum Beispiel Wassily Kandinsky, Paul Klee und Johannes Itten sahen in Goethe den großen Emanzipator der reinen Farben.
Die formanalytischen Auffassungen von Erwin Ratz sind durchdrungen Johann Wolfgang v. Goethes Ideen der Morphologie :
Auch innerhalb des Pflanzenreiches scheint es zunächst, als würde kein gemeinsames Prinzip auffindbar sein, das den so verschiedenartigen Formen zugrunde liegen könnte. Und doch hat sich dem anschauenden Denken Goethes ein solches Prinzip in der Idee der Urpflanze erschlossen.
Erwin Ratz, »Über die Architektonik in den Fugen J. S. Bachs«, in: Österreichische Musikzeitschrift 5 (1950), Heft JG, 196–205, zit. n. ders. Gesammelte Aufsätze, hrsg. von F. C. Heller, Wien 1975, S. 35.
Analog dem Begriff der Urpflanze in der Metamorphosenlehre Goethes legt auch die funktionelle Formenlehre ihren Betrachtungen eine Urform zugrunde, aus der sämtliche Formen von den einfachsten (Scherzo) bis zu den kompliziertesten (Sonatenform und Fuge) und den zusammengesetzten Formen (Rondo) abzuleiten sind.
Erwin Ratz, »Über die Bedeutung der funktionellen Formenlehre für die Erkenntnis des Wohltemperierten Klaviers«, in: Die Musikforschung 21 (1968), S. 17−21, S. 17.
Wesentlich für die Formauffassung von Erwin Ratz ist die Funktion musikalischer Gestaltungen. Darunter verstand er entsprechend Goethes Morphologie die Aufgabe, die ein Element in einem Zusammenhang erfüllt:
Anhand der harmonischen Ereignisse, aber auch auf Grund der motivischen-thematischen Struktur sind wir in der Lage, uns über die Gliederung und Zusammengehörigkeit der einzelnen Gruppen, sowie über ihre gegenseitige Beziehung Rechenschaft zu geben.
Erwin Ratz »Musikalische Formenlehre als pädagogische Aufgabe«, in: Wort und Tat, Paris und Wien 9/1947, S. 7 ff., zit. nach Ratz a.a.O. 1975, S. 21.
Es ist bekannt, dass sich auch der Wiener Musiktheoretiker Heinrich Schenker wurde von Goethe beeinflusst. Auf der Ebene der verwendeten Terminologie ist die Nähe zwischen Goethes Morphologie und dem musiktheoretischem Denken von Heinrich Schenker und Erwin Ratz offensichtlich:
J. W. v. Goethe | H. Schenker | E. Ratz |
|---|---|---|
Urpflanze | Ursatz/Urlinie | Urform |
Samen | Tonikadreiklang | Klang (Tonika) |
vis centrifuga | Auskomponierung | Auskomponierung |
vis centripeta | Diminution | Gestaltungen |
Den Begriff der Urform erwähnt Erwin Ratz erstmalig am Ende des Aufsatzes »Über die Architektonik in den Fugen J. S. Bachs« (1950). In einem späteren Aufsatz führt er dazu aus:
Analog dem Begriff der Urpflanze in der Metamorphosenlehre Goethes legt auch die funktionelle Formenlehre ihren Betrachtungen eine Urform zugrunde, aus der sämtliche Formen von den einfachsten (Scherzo) bis zu den kompliziertesten (Sonatenform und Fuge) und den zusammengesetzten Formen (Rondo) abzuleiten sind. Diese Urform besteht aus fünf Teilen: ein Teil, der die Tonika exponiert, ein zweiter, der von der Tonika wegführt (Überleitung, erstes Zwischenspiel), ein Teil, der in fremden Regionen verweilt (Seitensatz, Durchführung), ein Teil, der zurückführt auf die Dominante der Haupttonart, und ein Teil, der die wieder erreichte Tonika bekräftigt (Reprise). Davon muß jede Formbetrachtung, die das musikalische Kunstwerk als einen in sich geschlossenen Organismus begreifen will, ausgehen.
Erwin Ratz, »Uber die Bedeutung der funktionellen Formenlehre für die Erkenntnis des Wohltemperierten Klaviers«, in: Die Musikforschung 21 (1968), S. 17−21.
Die Urform von Erwin Ratz lässt sich wie folgt veranschaulichen:
In Anbetracht der Tatsache, dass die »harmonischen Vorgänge […] ein wesentliches Element hinsichtlich der formalen Funktion darstellen« (ebd. 18), lässt sich die Urform als Modell aus zwei statischen Teilen auffassen (›Tonika exponieren‹ und ›Tonika bekräftigen‹), die durch drei dynamische Teile verbunden werden (›wegführen‹, ›in fremden Regionen verweilen‹ und ›zurückführen‹). Da für Erwin Ratz die V. Stufe zu den »fremden Regionen« zählt, lassen sich sogar die Urform von Ratz und der Ursatz von Heinrich Schenker in Beziehung setzen:
Es ist nicht bekannt, dass ein direkter Kontakt zwischen und Erin Ratz und Heinrich Schenker bestanden hat. Theoretisch könnten beide über die Universal Edition Kontakt gehabt haben, also über den Verlag, in dem die Werke beider Autoren verlegt worden sind. Unabhängig davon waren Erwin Ratz die Arbeiten von Heinrich Schenker bekannt, da er sie sehr geschätzt hat:
Heinrich Schenker geprägten Begriffe wertvolle Dienste, allerdings nur soweit es sich um Werke der Klassik handelt. Eine ausgezeichnete Einführung in diese Art der Betrachtung ist das Buch von Oswald J onas: Das Wesen des musikalischen Kunstwerks, Wien 1934.
Dies gilt in noch höherem Maße von Phil. Em. Bachs ›Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen‹, der auch heute noch das bedeutendste Lehrbuch für die den Meisterwerken der klassischen Periode zugrunde liegende und jene einzigartige Logik des inneren Zusammenhanges selbst bei großen Formen bewirkende Kunst der Stimmführung darstellt, wie dies Heinrich Schenker wiederholt in überzeugender Weise nachgewiesen hat.
a.a.O., S. 9 und S. 20.
Kritik
Quelle: YouTube
Biografie

Im Folgenden finden sich einige Hintergrundinformationen zum Leben und Wirken von Erwin Ratz. Wie bereits ausgeführt worden sind, hatte Goethes Morphologie einen großen Einfluss auf das Formverständnis von Erwin Ratz. Dieser Einfluss dürfte verstärkt worden sein durch sein Verhältnis zur Anthroposophie von Rudolf Steiner.
Erwin Ratz wurde 1898 in Graz geboren. Seine Mutter Marianne Gabriele Ratz gebar drei Jahre später ein weiteres Kind, Mart(h)a Irma Ratz. Der Vater, Dr. Florian Leo Ratz, forschte und lehrte als Assistent am ›chemischen Institute der k. und k. Universität in Graz‹. 1905 legte er eine ›Mitteilung‹ vor,(1) in der er schrieb, dass die »Untersuchung, welche aus besonderen Gründen am Nicotin begonnen wurde, […] nach Ausführung größerer Vorarbeiten abgebrochen werden« musste. Der Abbruch dieser Untersuchung und darüber hinaus der wissenschaftlichen Karriere des Vaters könnten in direktem Zusammenhang mit der Übersiedlung der Familie nach Wien gestanden haben, um die Existenz der 1863 gegründeten Bäckerei ›Tobias Ratz‹ zu sichern.(2) In Wien besuchte Erwin Ratz zuerst die evangelische Volksschule am Karlsplatz und anschließend das Realgymnasium. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs legte er für den Erhalt der Bäckerei die Konditormeisterprüfung(3) ab und übernahm für einige Monate sogar die Leitung des Unternehmens. Nach 1945 unterstützte er seine Mutter bei der Geschäftsführung und erst 1962, vier Jahre nach ihrem Tod, entschloss er sich zum Verkauf des Familienbesitzes. Erwin Ratz sah die Bäckerei als Verpflichtung und zeitlebens als große Belastung an, die ihm jedoch gleichzeitig »durch finanzielle Unabhängigkeit von Akademie und Verlagsarbeiten eine geistige Freiheit« ermöglicht und »ihn davor bewahrt hat, in der Enge des Daseins als Beamter oder Angestellter das Engagement für die tiefste und bedingungslose Erkenntnis musikalischer Kunstwerke zu verlieren«.(4)
Der Musik scheint sich Erwin Ratz erst relativ spät zugewandt zu haben.(5) Er lernte Arnold Schönberg nach eigener Aussage im Jahr 1917 »anläßlich einer Aufführung der Verklärten Nacht durch das Rosé-Quartett kennen«.(6) Ernst Hilmar verweist jedoch darauf, dass Verklärte Nacht vom Rosé-Quartett nicht 1917, sondern bereits am 15. Februar 1916 aufgeführt worden sei und vermutet deshalb, dass die Bekanntschaft 1916 erfolgt sein müsse.(7) Ab September 1917 nahm Erwin Ratz an dem Seminar für Komposition teil, das von Arnold Schönberg zur Unterweisung von Anfängern und Fortgeschrittenen aller sozialen Schichten eingerichtet worden war.(8) Später erhielt er von Schönberg (in unregelmäßigen Abständen) Unterricht als Privatschüler. 1918 beteiligte er sich maßgeblich an der formalen Realisierung der zehn öffentlichen Proben seines Lehrers zu dessen Kammersymphonie. In Folge dieses Projekts wurde der Verein für musikalische Privataufführungen(9) gegründet, dessen Vorstand Erwin Ratz angehörte.(10) Gleichzeitig besuchte er »auch – insgesamt vier Jahre lang – die Vorlesungen Guido Adlers am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien, vielleicht auch auf die Empfehlung von Anton v. Webern hin, der bei Adler 1902 bis 1906 studiert hatte«.(11) An der Universität Wien könnte Erwin Ratz in Kontakt mit Wilhelm Fischer gekommen sein, der dort seit 1912 als Assistent Guido Adlers (ab 1923 als ao. Univ.-Professor) beschäftigt war.(12)
1921 übersiedelte Erwin Ratz nach Weimar, um eine Stelle als Sekretär von Walter Gropius am staatlichen Bauhaus anzutreten. Hier lernte er seine erste Frau Leonie (Lonny) Ribbentrop kennen, die Rückkehr nach Wien erfolgte bereits 1922 oder 1923.(13) Dennoch dürften die »Vielzahl und Reichhaltigkeit der Eindrücke und die lebensumfassende Kunsthaltung am Bauhaus, die auch ein Interesse an den neuesten musikalischen Entwicklungen einschloss […] zu den entscheidenden Impulsen«(14) im Leben von Erwin Ratz gehört haben. 1926 heiratete er Leonie Ribbentrop, ein Jahr später wurde seine Tochter Brigitte Ratz geboren.
Über die beruflichen Tätigkeiten von Erwin Ratz zwischen 1923 und 1945 ist nicht viel bekannt, doch erscheint es ausgeschlossen, dass er durch die Beschäftigung mit Musik seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Er übernahm »wiederholt Lektorarbeiten auf Honorarbasis als freier Mitarbeiter«(15) für die Universal Edition, wurde aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit bedeutsamen Editionen betraut.(16) Nach dem Ruf von Arnold Schönberg 1926 an die Berliner Akademie der Künste setzte Erwin Ratz seine Studien bei Anton Webern fort. Darüber hinaus hat er zwischen 1930 und 1937 Kompositionen von Hanns Eisler ediert sowie Abschriften und Klavierauszüge erstellt.(17)
In den biographischen Beiträgen zur Person Ratz finden sich zum Zeitabschnitt zwischen 1923 und 1945 zahlreiche Hinweise auf ein ausgeprägtes soziales Engagement. Er war von 1920 bis 1934 Mitglied in der Kommunistischen Partei Deutsch-Österreichs (KPDÖ) und setzte sich für kulturelle Angelegenheiten ein. Ab Mitte der 1930er Jahre wandte er sich verstärkt der Anthroposophie zu, deren überzeugter Anhänger er wurde und zeitlebens blieb. Nach Friedrich Saaten, einem Musikschriftsteller und Mitarbeiter der Österreichischen Musikzeitschrift, spielten letzten Endes »die Lehre Rudolf Steiners wie der prägende Einfluss Schönbergs in Ratz' Leben eine tragende Rolle«.(18) Darüber hinaus half er vielen, die durch das nationalsozialistische Regime oder den Krieg in Bedrängnis geraten waren wie z.B. Anton Webern, Hanns Eisler, Oscar Adler, Josef Polnauer, Georg Schönberg, Lizzy Berner, Jeanette Schenker (der Witwe von Heinrich Schenker), Hans Buchwald und vielen anderen. 2014 wurden Erwin Ratz und Leonie (Lonny) Ratz posthum von Yad Vashem, der Nationalen Gedenkstätte Jerusalem für die sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden, als Gerechte unter den Völkern anerkannt.(19)
Erst nach 1945 gelang es Erwin Ratz, seine musikwissenschaftliche Berufung zum Beruf zu machen. Noch im Jahr des Kriegsendes übernahm er einen Lehrauftrag an der Wiener Akademie für Musik und darstellende Kunst. Obgleich er im Kollegium nicht unumstritten war, wurde ihm 1957 der Professorentitel verliehen. Seine zweite Frau Inge Ratz,(20) die er 1947 heiratete, bezeichnete die Unterrichtstätigkeit an der Akademie als »Fixpunkt seines Lebens«,(21) seine Lehrtätigkeit endete 1969. Ab 1949 engagierte sich Erwin Ratz zudem in der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM), zuerst als Kassier und Vorstandsmitglied,(22) ab 1952 dann als Nachfolger von Herbert Häfner als Leiter der österreichischen Sektion.(23) 1955 beteiligte er sich an der Gründung der Mahler-Gesellschaft, deren erster Präsident er war und bis zu seinem Tod blieb. Insbesondere in dieser Funktion sowie als Leiter der Mahler-Gesamtausgabe erlangte er internationale Reputation. Seine Einführung in die musikalische Formenlehre veröffentlichte Erwin Ratz 1951. Er starb am 12. Dezember 1973 in Wien.
